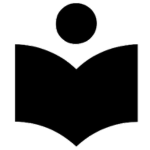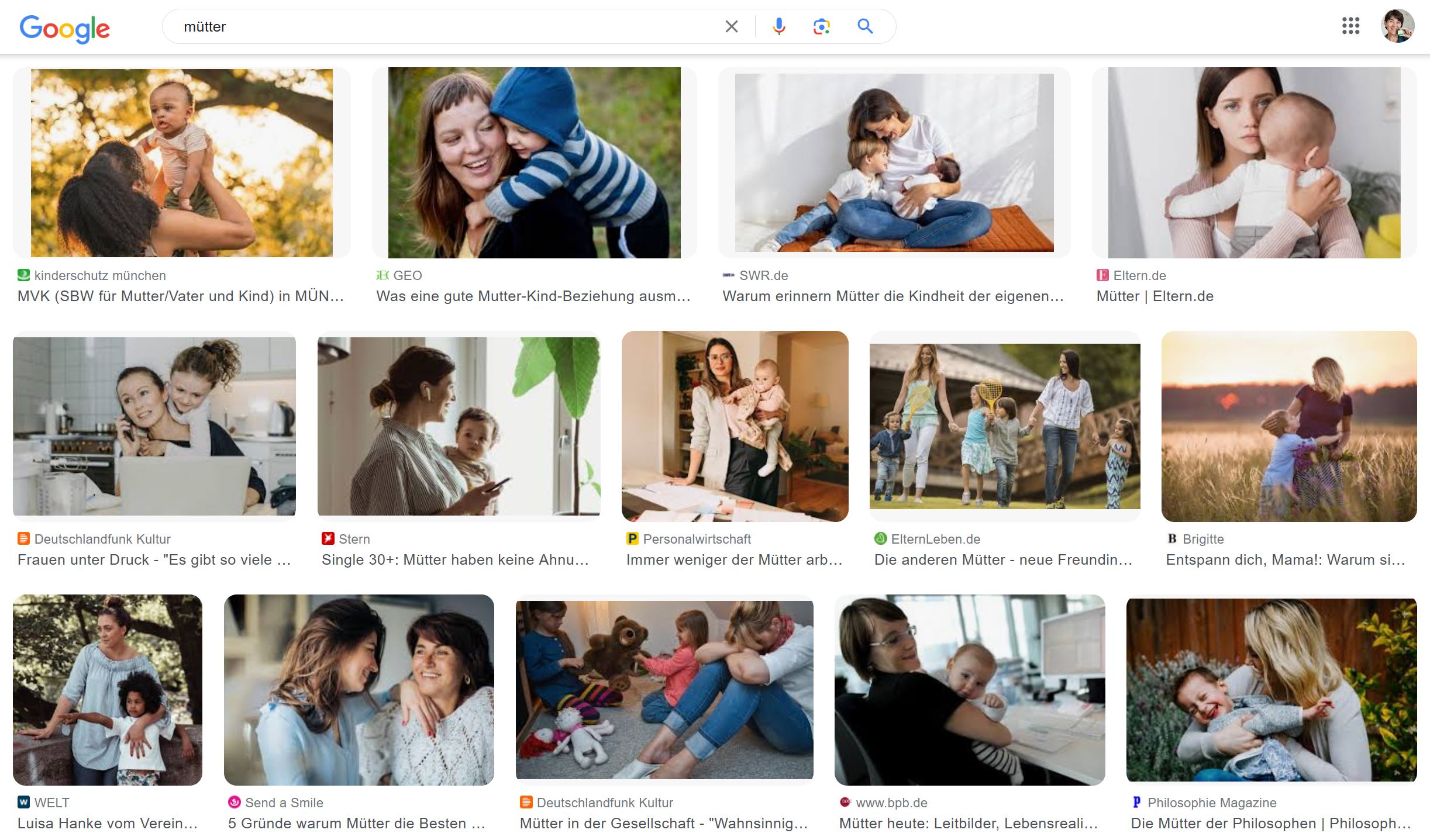Das per se ist erstmal nicht das Problem. Das Problem sind die Diskriminierungen, die wir Mütter dadurch erleben.
Was Mutterschaft mit uns macht
Mutterschaft ist ein soziales Konstrukt, das tief in die Strukturen unserer Gesellschaft eingebettet ist. Es geht über die biologische Tatsache der Geburt hinaus und wird durch eine Vielzahl kultureller, historischer und sozialer Faktoren geformt. Unsere Vorstellungen von Mutterschaft sind durch kulturelle Normen, gesellschaftliche Erwartungen und individuelle Erfahrungen geprägt. Dabei werden bestimmte Rollen und Verhaltensweisen mit der Mutterschaft verknüpft, die jedoch nicht von allen gleichermaßen erfüllt werden können. Mutterschaft wird so zu einem komplexen Netzwerk von Bedeutungen und Erwartungen, das die Identität von Menschen maßgeblich beeinflusst und gleichzeitig von ihnen geprägt wird.
Als ich das erste Mal Mutter wurde, wurde ich durch das Ideal der „perfekten Mutter“ beinahe aufgefressen. Die Vorstellung, dass eine Mutter in jeder Hinsicht für ihre Kinder sorgt, dabei stets geduldig, liebevoll und opferbereit ist, niemals um Hilfe fragt, nie müde und erschöpft ist, ließ mich fast verzweifeln. Ich suchte die Schuld bei mir. Erschöpfung, Sorgen und gesellschaftliche Erwartungen gesellten sich mit an den Esstisch. Ich versuchte mich zu opfern und scheiterte kläglich. Tagtäglich.
Die gesellschaftlichen Strukturen geben Halt, gleichzeitig rissen mir die daran geknüpften Erwartungen den Boden unter den Füssen weg. Es ist kein individuelles Versagen, wenn eine Mutter nicht mehr kann, schreit und weint, erschöpft ist, keine finanziellen Rücklagen hat, in Teilzeit arbeitet oder Gewalt erfährt. Es ist vor allem strukturell bedingt und ich würde sogar behaupten, es ist in unserer Gesellschaftsform strukturell gewollt, diese Lebensrealitäten als menschliches Versagen abzuwerten.
Zum Geschlecht und beispielsweise der sozialen Herkunft kommt die Rolle der Mutter hinzu, die eine weitere Diskriminierungsebene darstellen kann. Umso marginalisierter Menschen und ihre Lebensmodelle sind, desto mehr Diskriminierung erfahren sie. Deshalb ist es auch so wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Mit Prozessen der strukturellen Ungleichheit im Allgemeinen und auch mit intersektionalen Diskriminierungsformen. Es trifft ausgerechnet uns Mütter.
Motherhood Lifetime Penalty, Altersarmut, Teilzeitfalle, finanzielle Abhängigkeit das sind nur einige Stichworte, die struktureller Ungleichheit gegenüber Carepersonen einen Namen geben.
Als Familienfotografin und Soziologin habe ich mich entschieden, nicht den medialen Konstrukten von Mutterschaft und Care zu folgen, sondern diese dokumentarisch aufzuarbeiten und zu dekonstruieren. Auch für mich selbst. Denn auch ich und meine tägliche Care-Arbeit war nicht zu sehen. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Mama, wo warst du?
Als mich mein älteres Kind, gerade mal 3 Jahre alt, nach dem Urlaub fragte, ob ich denn überhaupt dabei gewesen sei, fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ich war auf fast keinem der Urlaubsbilder und Videos zu sehen. Für meine Kinder war ich nicht dabei. Ich blätterte die Alben der letzten Jahre durch und fing an zu zählen. Die Fotos mit mir drauf. Ich fand nur eine Handvoll.
Vor allem die Zeit der Schwangerschaften und des Wochenbettes ist fast nicht dokumentiert. Ich spielte die Hauptrolle, war aber nie zu sehen. Süße Fingerchen, Füßchen, kleine feine Babygesichter, aber kein einziges Bild von mir. Keins, dass mich im Alltag zeigt.
Mit dieser Erkenntnis schrieb ich auf Instagram einen Post, um mir Luft zu verschaffen. Ich habe noch nie so viele Nachrichten zu einem Thema bekommen. So geht es Vielen, die mit ihren Profilen oder auch Umfragen auf dieses Thema aufmerksam machen.
Mütter und primäre Sorgepersonen sind gar nicht oder viel zu selten auf Fotos zu sehen, obwohl sie in der Mehrheit immer noch diejenigen sind, die die meiste Fürsorgearbeit leisten. Und sich paradoxerweise auch noch verpflichtet fühlen, dafür zu sorgen, dass Erinnerungen überhaupt existieren. Sie gestalten Fotoalben, machen Bilder von kleinen und großen Momenten in der Familie, fotografieren alltägliche Szenen, schreiben erste Schritte und erste Wörter auf. Es liegt in der „Natur“ der Sache, dass sie sich selbst dabei vergessen und das ist wohl eine logische Konsequenz unserer Gesellschaft, die von Müttern alles abverlangt, sie gleichzeitig aber in den Hintergrund drängt. Das alles ist kein Einzelphänomen, sondern strukturell begründet.
Seitdem ich selbst Mutter bin, liegt mein Fokus deshalb insbesondere auf der Sichtbarmachung von Müttern, Menschen in Erziehungsverantwortung und ihrer täglichen Care-Arbeit. Mir geht es darum, zu zeigen, was dieses Muttersein eigentlich für so viele Menschen bedeutet. Wie viele Erwartungen und Normen an dieses Muttersein geknüpft sind. Wie stark gesellschaftliche Normative und Strukturen auf uns wirken. Wie viel Freude, aber auch Druck Mütter heutzutage mit sich herumschleppen.
Zu sehen und lesen, dass es vielen Müttern ähnlich geht wie mir, gibt mir das Gefühl, nicht so allein zu sein. Denn was ich sehe, wahrnehme, höre, prägt mein Sein. Und rechtfertigt es auch. Emilia Roig bringt es mit einem Zitat aus ihrem unglaublich inspirierenden Buch „Why we matter“ auf den Punkt: „Nicht gesehen zu werden, nicht gehört zu werden, ist unerträglich. Weil es unsere Menschlichkeit infrage stellt.“ Ich möchte Müttern mit meinen Bildern und Geschichten diese Plattform geben.
Mit jedem Bild, das ich mache, stelle ich mir die Frage: Wie kann ich Mütter und Care-Personen und deren Lebensrealitäten und Erfahrungen darstellen? Diese Suche führte mich zu einer Auseinandersetzung mit dem Konzept der Intersektionalität. Es wurde mir klar, dass strukturelle Ungleichheit niemals isoliert betrachtet werden kann. Vielmehr müssen wir die vielschichtigen Schnittpunkte von Identitätsmerkmalen wie Geschlecht, Rasse, Klasse, Sexualität und mehr berücksichtigen, um ein vollständiges Bild der Realität zu erhalten. Denn zum Geschlecht und beispielsweise der sozialen Herkunft kommt nun auch die Rolle der Mutter hinzu, die eine weitere Diskriminierungsebene darstellen kann.
Um den Begriff der Intersektionalität beispielhaft zu skizzieren, ist dieses Zitat aus meinem Buch „Bis eine* weint!“ perfekt.
Ninia la Grande:
„Zudem kommt, dass durch meine Kleinwüchsigkeit mir Menschen sowieso schon einmal anders begegnen als anderen Leuten. Das fängt damit an, dass sie überlegen, ob ich wirklich die Mutter bin. Insgesamt ist die Diskriminierung mir gegenüber extremer und deutlicher geworden, seitdem ich Mutter bin. Wenn man nur klein ist, sind es vor allem die alltäglichen Dinge wie Bankautomat zu hoch, Straßenbahn einsteigen, öffentliche Toiletten benutzen et cetera. Und gerade der Punkt mit den Blicken und den komischen Nachfragen ist viel mehr geworden als früher, gerade als der Bauch da war und dann das Kind zur Welt kam, weil sich die Leute einfach fragten: „Wie konnte das passieren? Warum hat sie eine Beziehung? Wie alt ist sie? Ist sie wirklich die Mutter?“
Mein Anspruch als Fotografin
Ich möchte Lebensrealitäten nahbar und zugänglich machen und so auch auf strukturelle Ungleichheit aufmerksam machen. Ich möchte, dass Menschen meine Fotografien anschauen und genau darüber nachdenken, was es mit ihnen macht. Welche Privilegien sie haben, welchen Kontext sie sehen und vor allem, welche Erkenntnisse sie für sich selbst finden. Als Bildschaffende möchte ich ganz behutsam mit diesem Medium umgehen und bei der Reflexion stets auch meine eigene Stellung in der Gesellschaft hinterfragen.
Als Fotografin stehe ich dabei immer vor der Herausforderung, strukturelle Ungleichheiten aufzeigen zu wollen, ohne Stereotype zu reproduzieren. Es ist wichtig, sensibel mit den Geschichten und Erfahrungen der Menschen umzugehen, die ich fotografiere, und ihre Perspektiven authentisch zu repräsentieren. Gleichzeitig will ich auch neue Lebensmodelle und andere Sichtweisen zeigen. Deshalb fotografiere ich in meiner fortlaufenden Serie „M*thers“ Care-Personen, die sich in vielerlei Hinsicht mit der Care-Frage auseinandersetzen.
Hier stehen traditionelle Mütter, Nicht-Mütter, Mütter, die ihre Kinder verloren haben, pflegende Mütter, Co-Mütter, alleinerziehende Mütter, queere Mütter und Menschen, die sich die Frage nach Kindern stellen, nebeneinander. Menschen, die diese Wörter „Mutterschaft und Care“ auf ganz unterschiedliche Weise mit Leben füllen. Es gilt, auch deren Lebensrealitäten und Geschichten zu erzählen, sie sichtbar zu machen. Anzuerkennen.
Ich möchte dabei Fragen aufwerfen: Wie wird Mutterschaft heute gelebt? Was ist das Ideal von Mutterschaft? Und wie wird es in den Medien dargestellt? Wie beeinflussen uns diese Konstruktionen im Erleben des eigenen Mutter- und Elternseins? Welche gesellschaftlichen Normative gelten und welche politischen Rahmenbedingungen konstruieren dieses Bild von Mutter- und Elternschaft? Welche neuen Lebensmodelle gibt es und könnte es geben? Welche politischen Veränderungen muss es geben? Welche Rolle spielt Kapitalismus in der Frage nach der Zukunft von Care?
Medien prägen das Rollenbild von Müttern
Wenn ich fernsehe, Serien anschaue, durch Social Media scrolle oder Werbung betrachte, begegne ich oft den gleichen Bildern von Mutterschaft und Care-Arbeit. Überall sehe ich strahlende Mütter, die scheinbar mühelos ihre Kinder versorgen, den Haushalt führen und gleichzeitig erfolgreich im Beruf sind. Diese Bilder suggerieren ein Ideal von Mutterschaft, das oft unerreichbar und unrealistisch ist.
Es fühlt sich an, als würden diese Rollenbilder unaufhörlich in mein Bewusstsein eindringen und mir vorschreiben, wie ich als Frau, Partnerin und Mutter zu sein habe.
Trotz meiner bewussten Bemühungen, diese Stereotypen zu hinterfragen, merke ich, wie sich diese Rollenbilder dennoch in meinem Verständnis von Mutterschaft und Care-Arbeit breitmachen und mein Denken und Handeln beeinflussen. Wie ich diese Stereotype selbst teilweise reproduziere und andere Care-Personen verurteile. Es erfordert ein bewusstes und permanentes Auseinandersetzen und Hinterfragen dieser internalisierten Stereotype, um diese dann auch aufzubrechen. Das wiederum braucht Kapazitäten, Privilegien und auch Mut, es anders zu machen.
Mit Fotografie ein neues Bild der Mütter schaffen
Oft klafft eine Lücke zwischen den idealisierten Darstellungen von Mutterschaft in den Medien und der Realität, mit der Mütter konfrontiert sind. Die Diskrepanz zwischen diesen Bildern und den tatsächlichen Erfahrungen kann zu einer Herausforderung werden und das Selbstbild von Müttern stark beeinflussen. Als Fotografin strukturelle Ungleichheit zu benennen, bedeutet zuallererst zu wissen, dass es strukturelle Barrieren und Ungerechtigkeiten gibt, die bestimmte Gruppen in unserer Gesellschaft benachteiligen und marginalisieren.
Dieses Wissen zu reflektieren ist wichtig, auch im eigenen Handeln und der fotografischen Arbeit. Wie stelle ich als Fotografin Familien und insbesondere Mütter bzw. Care-Personen dar? Wer kann sich meine Shootings leisten? Wer wird gezeigt und wer bestimmt, was gezeigt wird? Wessen Lebensgeschichten sind es wert gesehen zu werden? Wer hat den Raum und die Zeit, sich damit auseinanderzusetzen?
Stereotypen aktiv anzugehen, bietet die Möglichkeit, durch das Bild selbst dem Stereotyp mit einem Gegenbild zu begegnen. Hier liegt wohl die Kraft der Fotografie: in der Schaffung von Alternativen und neuen Perspektiven. Es kann eine Chance sein, Stereotype zu hinterfragen, zu stören, zu dekonstruieren, Betroffenheit und eine unmittelbare emotionale Verbindung zu erzeugen und durch die Darstellung von Vielfalt und Individualität neue Narrative zu formen. Diese Geschichten sind demnach stets persönlich und exemplarisch zugleich. Das Verschränken von persönlichen und kollektiven Erfahrungen birgt die Möglichkeit eine Art „Wir“ zu erschaffen.
Faces of Moms*
Auf diesen Gedanken basiert unsere Kampagne Faces of Moms*, zu finden auf Instagram und auf unserer Website. Bei Faces of Moms* geht es darum, für den Wert von Care-Arbeit zu sensibilisieren und ein Bewusstsein für strukturelle Ungleichheit zu schaffen.
Aus den Erfahrungen zweier Freundinnen, die zur gleichen Zeit Mütter wurden, entstand die Idee für dieses Projekt, das auf Instagram seinen Ursprung hatte. Wir haben über die Herausforderungen gesprochen, denen wir täglich gegenüberstehen, über die Rollenbilder, die uns prägen, und über die Überforderung, die uns manchmal fast erdrückt. Dabei hat die Pandemie wie ein Brennglas auf uns gewirkt und uns dazu gebracht, zu fragen, warum so selten über diese Seite des Familienlebens gesprochen wird. Warum wird die Ungleichheit von Müttern nicht sichtbar gemacht? Warum wird die Care-Arbeit nicht angemessen gewürdigt? Diese Fragen haben uns angetrieben, für diese Fragen Facesofmoms* ins Leben zu rufen.
Faces of Moms* begann mit Interviews auf Instagram. Nicole Noller und ich stellten immer die drei gleichen Fragen: Was ist deine größte Herausforderung? Was ist dein größter Abfuck? Was würde dir helfen? Für dieses Konzept haben wir schnell viel Aufmerksamkeit bekommen. Viele Sorgepersonen haben sich angesprochen gefühlt, gesehen.
Wir merkten aber auch schnell, dass wir weitere Zugänge für dieses Thema wollten. Deshalb organisierten wir Ausstellungen, Workshops und Podiumsdiskussionen. Und wir schrieben ein Buch: „Bis eine* weint!“
Darin porträtieren wir 17 Mütter mit unterschiedlichen Lebensrealitäten und Herausforderungen. Egal ob alleinziehend, verheiratet, verpartnert, im Wechselmodell oder im Patch-Work, berufstätig oder nicht – die Verantwortung für eines oder mehrere Kinder ist eine langfristige Verpflichtung, die das Leben jeder Einzelnen der Porträtierten stark verändert hat und ihren Alltag bestimmt.
Wir sammeln in den offenen und sehr persönlichen Gesprächen Forderungen, wie die Bedingungen der Mutterschaft für alle verbessert werden könnten. Es geht um Rollenverständnisse, Arbeitsformen, Betreuungsstrukturen, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und die Anerkennung von Care-Arbeit. Vor allem geht es uns auch um eine generell stärkere Berücksichtigung von Familien und Frauen in politischen Debatten. Deswegen wurde „Bis eine* weint!“ auch von der Bundeszentrale für politische Bildung als gesellschaftsrelevantes Buch in seine Schriftenreihe aufgenommen.
Unser Ziel war es, über individuelle Erzählungen Perspektiven zu erweitern, die Vielfalt von Lebensrealitäten aufzuzeigen und das Bewusstsein für strukturelle Ungleichheit zu schärfen.
Kunst ist gut, wenn es neue Perspektiven eröffnet
Am Ende bleibt mir die Hoffnung, dass meine Bilder zu Geschichten werden und dass diese Geschichten weitergetragen, akzeptiert und anerkannt werden. Dass sie dazu beitragen, dass Menschen sich mit vielfältigen Realitäten von Mutterschaft und Care auseinandersetzen.
Nicole von Horst schreibt in „The Stories We Tell“:
„Die eigene Geschichte zu erzählen und die Geschichten von anderen zu hören und anzuerkennen, gehört zusammen. Es sind beides radikale Akte, die die Welt verändern. Und sei es nur die Welt eines einzelnen Menschen.“

© Natalie Sanczak
Natalie Sanczak
Gastautorin
In ihrer Kunst finden sich die Gesichter wieder, die aus Diskursen gestrichen wurden. Ihre Bilder rufen ganze Geschichten hervor. Die dokumentarische Familienfotografin und Soziologin Natalie Sanczak widmet sich der Sensibilisierung und Sichtbarmachung von struktureller Ungleichheit gegenüber Müttern und Carepersonen, Intersektionalität, Solidarität und Verbundenheit.
Bittere Realität von Mutterschaft: Jeden 3. Tag stirbt in Deutschland eine Frau durch die Gewalt ihres Partners oder Expartners. Oft sind es Mütter.