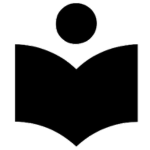Dieses zu Ende gehende, schwierige Jahr hat auch etwas Gutes: Geschlechtergerechtigkeit in der Sprache ist in aller Munde. Warum jetzt, warum so? Bereits Ende der 1970er Jahre begründeten Luise F. Pusch und Senta Trömel-Plötz die feministische Sprachkritik. Ihr Engagement hat die habilitierten Linguistinnen die Karriere an der Universität gekostet. Luise F. Pusch ist trotzdem dabei geblieben und hat Überzeugungsarbeit geleistet, in Büchern wie „Das Deutsche als Männersprache“, mit Vorträgen und sprachkritischen Glossen wie „Deutsch auf Vorderfrau“. Unermüdlich hat sie den Blick auf die blinden Flecken männlicher Sprache und Gesellschaft gelenkt und die Frauen aufgefordert, sich die Sprache zurückzuerobern.
36 Jahre „Das Deutsche als Männersprache“
Nun also, im Jahr 2020, der Durchbruch. „Was lange währt, wird endlich gut“, sagt Luise F. Pusch. Wie sieht die Doyenne der feministischen Sprachkritik den fulminanten Erfolg des Genderns? Ein Gespräch.
In Radio und Fernsehen wird inzwischen munter gegendert. Oft mit Beidnennung, manchmal mit Glottisschlag. Wie finden Sie das?
Glottisschlag – Das habe ich erfunden! 1985 oder 86, als sich das große I allmählich durchsetzte, wurde ich gefragt: Wie soll man das denn aussprechen? Meine Antwort: mit einer Minipause, heute auch bekannt als Knacklaut. Den gibt es in vielen deutschen Wörtern. In Kiel, wo in den frühen Siebzigern meine Universitätslaufbahn begann, kennen alle das Ostufer. Meine italienischen Kollegen sagten aber: Os-tufer oder auch Aben-dessen. Wir Deutsche sagen: Abend-essen.
Ich wurde ja oft nach der Aussprache gefragt, während meiner vielen Vorträge, auf Podien und Diskussionsveranstaltungen. Ich weiß nicht, ob ich die Idee irgendwo aufgeschrieben habe. Aber da ich die Lösung mit dem Glottisschlag selber vorgeschlagen habe, finde ich es gut, dass das nach 35 Jahren wieder aufgenommen wurde. Nun ja, die Queer-Community hat es als ihre Erfindung ausgegeben. Manches muss eben zweimal erfunden werden, es liegt ja nahe.
Das Gendersternchen ist auf Platz 9 bei der Wahl zum Wort des Jahres gelandet. Das Wort ist auch seit August im Duden vermerkt. Wie erklären Sie sich den Erfolg des Gendersternchens? Es steht für das Gendern.
Ich führe diese Bewegung auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts 2017 zur Dritten Option zurück und auf die professionelle Lobbyarbeit der Queer-Community, erst zum Unterstrich, der Gender-Gap, und dann zum Genderstern. Bei dieser zweiten sprachkritischen Bewegung sind viele Männer dabei und setzen sich mit ihrem männlichen Anspruchsdenken durch. Wir Frauen machen das anders: Wir sagen, das ist unser Vorschlag, macht’s wie Ihr wollt. Frauen neigen aber auch dazu, wie jetzt geschehen, sich für Männer stark zu machen. Nur dieses Mal nützt es auch den Frauen.
Auf dem Umweg über diese sehr kleine Gruppe der nichtbinären und der intersexuellen Menschen, die jetzt also dringend berücksichtigt werden müssen gegenüber der Gruppe von 52 % Frauen, die 40 Jahre lang mit der Sprachkritik nicht gehört wurden, hat sich für mich so etwas durchgesetzt wie das generische Femininum – was ich immer propagiert habe. Insofern bin ich durchaus dabei und sage: Gut Jungs, habt Ihr gut gemacht!
Sie formulieren deutliche Kritik am Gendersternchen: Warum eigentlich?
Wir haben zwei sprachkritische Bewegungen mit völlig unterschiedlichen Zielen: Die einen wollen die Heteronormativität und die binäre Geschlechterordnung abschaffen und die anderen die Unterordnung der Frau in der Sprache. Was die Queer-Community nicht sieht und anerkennt ist, dass das eine Geschlecht, und zwar die Mehrheit, untergeordnet wird, sprachlich. Die tun ja so, als wären wir gleichberechtigt. Und jetzt wird von uns verlangt, wir müssten diese andere, unterdrückte Gruppe fördern und deren Lösung akzeptieren. Dabei sind die Ziele so unterschiedlich, und das wird kaum zum Thema gemacht.
Die Queer-Community hat das Ganze als Platzhalter konzipiert, der Unterstrich stand für die Gruppe, die dazwischen steht, zwischen Männern und Frauen. Und das ist ein Fehler: Männer bekommen damit den Wortstamm und die Frauen wieder bloß die blöde Endung –innen. Also, selbst wenn ich das nun, wie das große I, mit dem Knacklaut ausspreche, hätte ich das Sternchen gern woanders. Das Femininum darf nicht durch den Genderstern zerrissen, zerlegt, in drei Teile geteilt werden.
Alternative Ideen zum Genderstern, da haben Sie sich etwas einfallen lassen.
Ich hatte ja den Vorschlag einer Fusion gemacht. Sie erinnern sich an mein Grußwort zum Start von Genderleicht: ein Sternchen über dem I, so wie wir als Mädchen ein Herzchen über das I gemalt haben. Aber weil wir das als Zeichen auf der Tastatur noch nicht haben, machen wir doch ein Ausrufungszeichen! Oder was ich auch hübsch finde, ist ein Zirkumflex statt eines Sternchens, das kleine Dach auf einem Vokal tippt sich sehr gut. Oder wir denken an ein Wort wie 50+ und machen ein Pluszeichen ans Ende: Lehrerinnen+.
Journalist!n
Journalistîn
Journalistin+
Journalistin*
Wir müssten den Genderstern als Meta-Symbol begreifen. Es ist egal, ob er am Anfang oder am Ende des Wortes steht, aber bitte nicht in der Mitte. Ähnlich wie die Gänsefüßchen, also die Anführungszeichen, angeben, hier haben wir ein Zitat, oder anzeigen: das ist ironisch gemeint. Ein Gendersternchen irgendwo am Wort würde also bedeuten: Dieses Wort ist inklusiv. Alle Geschlechter sind gemeint.
Kommen wir zu einigen Genderdiskussionen, die uns in 2020 bewegt haben. Mich würde Ihre Meinung dazu interessieren.
Manche verweisen auf das Englische: Personenbezeichnungen wie actor oder doctor sind geschlechtsneutral. So möchte auch Nele Pollatschek als Schriftsteller bezeichnet werden.
Englisch oder die skandinavische Sprachen werden als vorbildlich angeführt ohne Kenntnis des sprachlichen Systems dahinter. Ich höre das seit 35 Jahren und muss es immer wieder erklären und korrigieren: Bei wirklich neutralen Wörtern wie teacher, actor, student oder poet kann ich mit he oder she fortfahren.
Wenn es ein Wort gibt, das beide Geschlechter meint, dann aber für Frauen zusätzlich ein Wort gemacht wird, das keinen Anspruch auf den allgemeinen Begriff hat, werden sie damit verkleinert: Die poetess ist kein richtiger Dichter, sondern „nur“ eine weibliche Dichterin: „die machen da so ihren Kleinkram und keine ernstzunehmende Dichtkunst“. Deswegen ist es eine Beleidigung, wenn ich von poetess spreche. Oder im Dänischen von laererinde für eine Lehrerin.
Im Deutschen liegen die Verhältnisse aber ganz anders. Wir haben im Deutschen, anders als im Englischen oder Dänischen, keine neutralen Personenbezeichnungen. Es gibt nur eine behauptete, eine Pseudoneutralität. Bei einem Wort wie Lehrer können wir nicht mit sie fortfahren: Ich habe einen Lehrer, die sehr nett ist. Das geht nicht. Sie erkennen diese angebliche Neutralität genau daran, dass Sie sich nur im Maskulinum auf Lehrer beziehen können. Im Englischen dagegen können wir sagen: My teacher is very nice, she is …
Das Jahr 2020 ist davon geprägt, dass immer mehr Menschen Geschlechtergerechtigkeit beim Sprechen und Schreiben ausprobieren. Die Gegner kritisieren das als Sprachpolizei. Was denn nun?
Man muss differenzieren. Die Städte Hannover, Berlin, Lübeck, Kiel und andere haben da Vorschriften gemacht, wo sie Vorschriften machen können: Die Amtssprache kann reguliert werden. Das Amt kann seinen Beschäftigten sagen: „Bitte bemüht Euch, in Euren Schreiben und Formularen alle Geschlechter anzusprechen“. Für die normale Sprache, die wir alle sprechen, können die gar keine Vorschriften machen.
Ich verstehe schon, wenn Schriftstellerinnen wie Monika Maron oder Katja Lange-Müller sich Sorgen machen, dass sie eines Tages mit Sternchen oder mit der Doppelform schreiben sollen. Das ist nicht einfach, plötzlich anders sprechen oder schreiben zu sollen, weil sich die Gesellschaft ändert. Sie fragen sich, ob die Sprache, mit der sie 70 Jahre lang gearbeitet haben, nicht mehr richtig ist. Dagegen wehren sie sich und nennen das Sprachpolizei.
Ich sage Nein! Das ist eine Basisbewegung. Sie wurde jahrzehntelang vom Establishment – ob akademisch, literarisch, journalistisch oder administrativ – ignoriert oder nicht ernst genommen. Wir sagen nur: Seht Ihr nicht, dass das eine männliche Sprache ist? Wollt Ihr ewig so weitermachen?
Der journalistische Nachwuchs, Frauen und Männer, will gendern und sagt: Unser Publikum will das hören und lesen. Die Leitungsebene vieler Medien öffnet sich dafür, entscheidet aber, wie gerade beim Bayrischen Rundfunk geschehen: Lasst uns differenzieren, in Sendungen mit einer älteren Zielgruppe sprecht Ihr das Sternchen nicht.
Früher konnten wir Feministinnen mit unserer Sprachkritik immer übergebügelt werden. Das war wohl so auch in den Redaktionssitzungen. Das ist jetzt anders, die Sprache wird neu verhandelt. Jetzt fühlt sich aber die konservative Seite in die Ecke gedrängt. Das gefällt ihr überhaupt nicht, und sie wehrt sich mit aller Macht.
Schauen wir auf die Sprache der Nachrichten oder der Werbung, hier sehen und hören wir oft das Sternchen. Trotzdem scheint das generische Maskulinum unverzichtbar: Es ist einfach kürzer, ohne das Anhängsel -in.
Das Maskulinum ist immer „besser“ als das Femininum, das ist die Geschlechterhierarchie des Patriarchats. Es gibt Sprachen, da ist das Femininum kürzer und das Maskulinum länger. Trotzdem gilt auch da: das Maskulinum ist „besser“, es ist daher die Grundform, das Femininum die Schwundform. Diese Grundhaltung sollten wir uns abschauen: Ministerin ist die Grundform, Minister die Schwundform. Dieses länger und lästig müssen wir nicht akzeptieren.
Das Deutsche lässt sich so beschreiben: Die Frau ist nicht der Rede wert, egal wie viele da sind. Kommt ein Mann hinzu, wird die ganze Sache männlich. Selbst wenn es nur hypothetisch ist, wie bei „Wer wird Millionär?“. Wird ein Mann als „Millionärin“ bezeichnet, empfindet er das als beleidigend. Die Männer dürfen auf gar keinen Fall feminisiert werden.
Das Femininum in einem Referentenentwurf für das Insolvenzrecht sorgte im Oktober für Aufregung: Das Justizministerium hatte in die Vorlage weibliche Wörter hineingeschrieben wie Gläubigerin und Schuldnerin.
Ich bin dazu oft um Stellungnahme gebeten worden. Die Gläubigerin oder die Schuldnerin sind in diesem Zusammenhang nur scheinbare Personenbezeichnungen. Das ist gar kein generisches Femininum! Das ist einfach die Kongruenz nach altem römischen Recht, auf dem das deutsche Recht fußt. Das Lateinische ist sehr streng kongruent. Deswegen heißt es auch in der Rechtssprache: Klägerin ist die Firma Sowieso, oder Die Stadt als Arbeitgeberin, Die Kirche als Grundherrin. Wenn die also in dem Gesetzentwurf immerzu von Firmen sprechen, dann müssen sie das Femininum verwenden. Das ist die Rechtssprache.
Ich fand das ganz geschickt, was Bundesjustizministerin Christine Lambrecht aus der Kritik gemacht hat. Sie hat das Missverständnis der Öffentlichkeit positiv umgedreht und darauf hingewiesen, dass auch in der Sprache des Rechts Frauen unsichtbar sind und dass das anders werden müsste.
Frau Pusch, ich danke für das Gespräch.
Mehr dazu
Genderzeichen und Co. im Überblick
Senta Trömel-Plötz, Co-Gründerin der feministischen Lingustik im deutschsprachigen Raum: in FemBio
Luise F. Pusch: Die feministische Linguistik hat ihr Leben bestimmt
Filmisches Portrait: Luise F. Pusch – Hindernislauf mit Happy End

© Katrin Dinkel
Christine Olderdissen
Genderleicht & Bildermächtig Projektleiterin
Als das erste Mal eine Interviewpartnerin mit dem Glottisschlag sprach, war das für sie ein Signal: Schluss mit dem generischen Maskulinum, lieber nach einer sprachlichen Alternative suchen. Eine einfache und elegante Lösung findet sich immer. Lange Zeit Fernsehjournalistin galt ihr Augenmerk schon immer der Berichterstattung ohne Stereotype und Klischees.
Ideen und Impulse
Bei Genderleicht & Bildermächtig finden Sie Argumente und Fakten sowie Tipps und Tools für die gendersensible Medienarbeit.
Newsletter
Was gibt es Neues beim Gendern? Was tut sich bei Bildermächtig? Wir halten Sie auf dem Laufenden, immer zur Mitte des Monats.