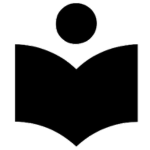Ach ja, was waren das noch für Zeiten mit dem Binnen-I. In Wörter wie „InnenministerInnen“ oder „InnenarchitektInnen“ hab ich mich in den 1980er Jahren geradezu verliebt, sie lesen sich rückwärts fast genauso wie vorwärts.
Als taz-Gründungsmitglied und taz-Redakteurin bis 1996 habe ich den langen Marsch des großen I durch die Institutionen mitverfolgt und aktiv mitbetrieben – wobei ihm das ähnlich wie den 1968ern am Ende kein Glück brachte, sondern seine gemeine hinterhältige Abschaffung.
Ein langer Marsch durch die Institutionen
Als „Erfinder“ des Binnen-I gilt der nunmehr 75-jährige Drehbuchautor Christoph Busch, der heutzutage in seinem „Zuhörkiosk“ in einem Hamburger U-Bahnhof ehrenamtlich Menschen zuhört, die ihm ihre Geschichte erzählen wollen. 1981 hatte Busch ein Buch über freie Radios veröffentlicht, und seine „HörerInnen“ wanderten in ein Flugblatt des Züricher freien Radios LoRa, das ab Herbst 1983 sendete. Die Züricher Wochenzeitung WoZ übernahm das Binnen-I, dann, Mitte der 1980er Jahre, die taz. Ich war sehr dankbar für diese EinwanderIn, denn in unserer Redaktion wütete weiland noch der schreckliche Schrägstrich, der schönen Sprachfluss in „Bürger/innen“ oder „Politiker/innen“ zerhackte.
Die taz als Bühne für das große I
Die taz war damals übrigens auch die erste quotierte Redaktion. Wir taz-Frauen hatten 1980 die erste bundesdeutsche Frauenquote ertrotzt, indem wir streikten und auf einem taz-Plenum kollektiv unseren Busen entblößten. Die taz-Männer waren darob so verblüfft, dass sie willenlos der Einführung der Quote zustimmten. Von dort wanderte sie in die Grünen und die SPD, später in kleingeschrumpelter Form auch in die Union und anderswohin.
Das Binnen-I wurde in gewisser Weise zum Symbol für die Quote und die zunehmende Sichtbarkeit der Redakteurinnen. Allerdings herrscht(e) damals wie heute in der antiautoritären taz der Konsens, dass Alle so schreiben dürfen, wie es ihnen gefällt. Das führte dazu, dass die Frauen mehrheitlich das I verwendeten, während viele Männer stur mit dem alten generischen Maskulinum weiterschrieben. Redaktion und Korrektur redigierten anfangs das I hinein, später redigierten sie es wieder hinaus. So leise, wie es gekommen war, verschwand es wieder.
In einer per Zufallsprinzip ausgewählten taz-Ausgabe vom März 1998 fand ein taz-Redakteur einen I-Anteil von unter 10 Prozent, von 41 Texten waren ganze 3 geschlechtergerecht verfasst. Fünf Jahre später zählte ich in einer ebenfalls beliebig ausgewählten taz-Ausgabe vom März 2003 kein einziges I mehr. Es war unmodern geworden, sich als FeministIn sichtbar zu machen – in der ganzen Gesellschaft. Die Frauenbewegung galt als „altbacken“.
Lustiger- und listigerweise marschierte aber das große I davon völlig unbeeindruckt weiter durch die Institutionen. Der Berliner Innensenator Erich Pätzold (SPD) ordnete es auf Anregung der grünen Frauen-Senatorin Anne Klein im Juli 1989 für den gesamten Dienstverkehr an. Stellenanzeigen von Behörden oder Universitäten wurden für „AmtsleiterInnen“ oder „Professor/innen“ ausgeschrieben. Ausgerechnet der Staat sicherte ein Mindestmaß an Geschlechtergerechtigkeit gegen den zunehmenden Antifeminismus in der Gesellschaft. Zur Jahrtausendwende überwinterte das Binnen-I in den Amtsstuben, während viele Karrierefrauen betonten, sie seien keine „Quotilden“ und fänden eine geschlechtergerechte Sprache überflüssig.
Nur ab und zu gab es überraschende Neuerungen, etwa die Einführung des generischen Femininums in den Schriftverkehr der Universität Leipzig, mitangestoßen durch Horst Simon, der sich selbst als „Linguistin“ bezeichnet. In einem 2013 geführten Interview des Tagesspiegel führte er zur Begründung aus: „In unserem judeo-christlichen Weltbild ist der Standardmensch in der Tat der Mann, die Frau die nachgebildete Sonderform“, das sei ungerecht. Nur in manchen Indianersprachen finde sich ein generisches Femininum. Oder auch Klassifizierungen, die sich auf Mythen zurückführen lassen: „So haben die Aborigines in Australien ein gemeinsames Genus für Feuer, Frauen und gefährliche Tiere, ein anderes für Männer, Schnecken und Speisefische.“ Merke: Frauen sind gefährliche Tiere, Männer Schnecken.
Die Verdrängung des Binnen-I
Und dann? Dann kam #MeToo. Im Oktober 2017 machten Schauspielerinnen unter diesem Hashtag die sexuellen Erpressungen von Filmregisseur Harvey Weinstein öffentlich. Es folgte ein weltweiter Aufschrei. Die Frauen- und Queerbewegung meldete sich mit riesigen Demonstrationen zurück. Seitdem gibt es eine Explosion von vielfältigen Formen, um Sprache geschlechtergerecht zu gestalten. Im Deutschen fällt das natürlich anders aus als im vergleichsweise genderneutralen Englischen oder Türkischen.
Auch in der taz wimmelte es plötzlich von neuen Sprachbildungen wie Schüler:innen, Lehrer.innen, Politiker!nnen, Beamt_innen und Musiker*innen. Doch mit dem guten alten Binnen-I, der feministischen VorreiterIn aller neuen Formen, ging das Schicksal brutal um: Es wurde fast ausgerottet.
Das Gendersternchen hat heute alle anderen Formen weitgehend plattgewalzt. In einer beliebig ausgewählten Ausgabe von Anfang 2021 habe ich auf den Politik-und Meinungsseiten insgesamt 21 Artikel und Kommentare gezählt, davon trotz Frauenquote 14 von Männern und nur 7 von Frauen. Die 14 Autoren suhlten sich mehrheitlich immer noch im generischen Maskulinum, nur 3 von 14 benutzten das Gendersternchen. Die 7 Autorinnen schrieben allesamt mit dem *.
Ich finde das schade. Ja, und ich bekenne: Ich trauere dem Binnen-I hinterher. Es war so schön einfach und klar. Anders als der Genderstern sah es aus wie eine Krücke und sollte es auch sein. Und, noch wichtiger: Wir sind in Zeiten der Vielfalt und Diversität gelandet. Und das sollte auch sichtbar werden. Mit allen Möglichkeiten, die wir jetzt haben, ob wir nun Leser:innen sind oder Autor:nnen, Hörer_innen oder Redakteur*innen, Zuschauer.innen oder Moderator:innen, InnenarchitektInnen oder InnenministerInnen.
Info: Die Genderzeichen
Das Binnen-I ist binär: Es stellt Männer und Frauen in einem Wort gleich. Der Genderstern dagegen verdeutlicht die geschlechtliche Vielfalt. Zwischen Wortstamm und weiblicher Endung platziert stehen seine Strahlen für die verschieden Ausprägungen von Geschlecht jenseits der Binarität. Das Gendersternchen bekommt inzwischen Konkurrenz vom Gender-Doppelpunkt. Er gilt als weniger störend im Schriftbild und barriere-ärmer. Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband hat den Doppelpunkt allerdings auf die Liste unerwünschter Genderzeichen gesetzt. Er empfiehlt für Kurzformen den Genderstern. Kritik kommt auch aus der Queer-Community: Nur die vielen Strahlen des Gendersterns entfalten die volle Symbolkraft für die geschlechtliche Vielfalt.
Weitere Genderzeichen auf einen Blick

© Peter Meyer
Ute Scheub
Gastautorin
Sie ist taz-Mitbegründerin, promovierte Politikwissenschaftlerin, freie Journalistin, Autorin von 23 Büchern und Geburtshelferin für Geschichten des Gelingens. In der taz gehörte sie zu den VerteidigerInnen des großen I, mittlerweile bevorzugt Ute Scheub den kleinen Punkt wie in Journalist.innen.
Ideen und Impulse
Bei Genderleicht & Bildermächtig finden Sie Argumente und Fakten sowie Tipps und Tools für die gendersensible Medienarbeit.
Newsletter
Was gibt es Neues beim Gendern? Was tut sich bei Bildermächtig? Wir halten Sie auf dem Laufenden, immer zur Mitte des Monats.